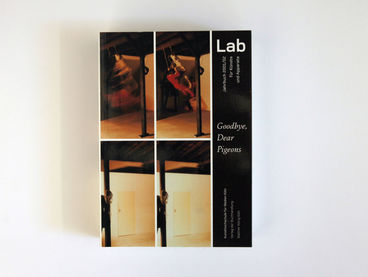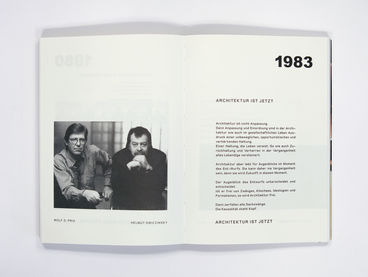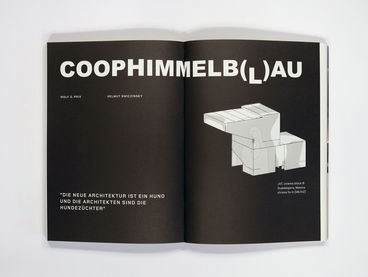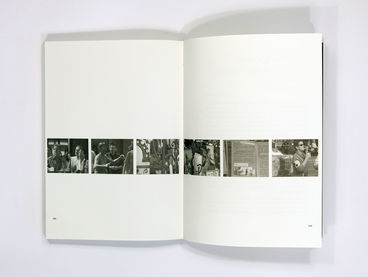- Exhibition
- Awards
- Library
- Speech
- edition KHM
- Festival / Award ceremony
- FG exMedia
- FG Film und TV
- FG Kunst
- FG Kunst- und Medienwissenschaften
- Movie screening
- Glasmoog Books
- Glasmoog - Raum für Kunst und Diskurs
- KHM Journal
- Concert
- Cooperation
- LAB Jahrbuch
- LECTURE Reihe
- Teachers elsewhere
- literature
- off topic
- News articles
- Publications
- Job offers
- Study
- TV broadcast
- Event
- all
Lab. Jahrbuch 2001/02 für Künste und Apparate
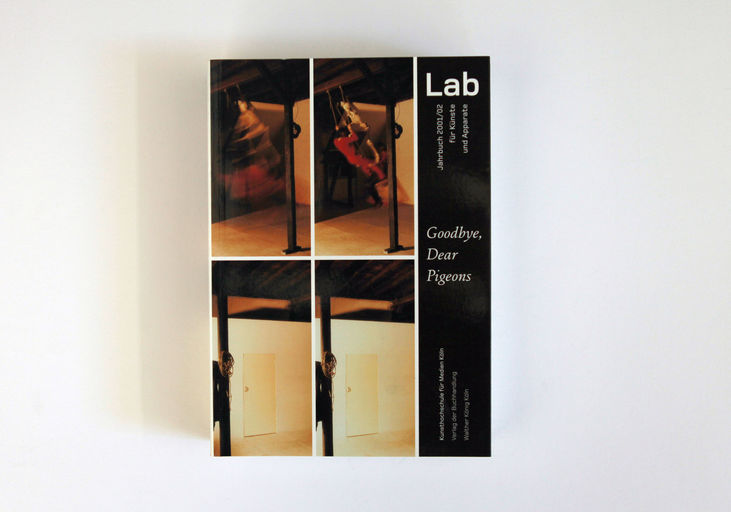
432 Seiten, 83 teils ganzseitige Abb. in S/W und Farbe, 21 x 14,8 cm, Klappenbroschur, Fadenheftung. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2002.
ISBN 3-88375-437-7
Hrsg.: Kunsthochschule für Medien Köln mit dem Verein der Freunde der Kunsthochschule für Medien Köln.
Redaktion: Thomas Hensel, Hans Ulrich Reck, Siegfried Zielinksi.
Editorial
In den Künsten, die in unterschiedlichen Materialformen und mit
diversen Strategien mit der ästhetischen Strukturierung von Zeit befasst
sind, gibt es zwei Protagonisten, die auch durch ihre sprachliche
Formulierungskunst herausragen. Für den kinematographischen Film und
seine Geschichte(n) stellte Jean-Luc Godard im ersten Teil seiner
Histoire(s) du cinéma die unverschämte Forderung auf: »Es ist an der
Zeit, dass das Leben zurückgibt, was es dem Kino gestohlen hat.«1 Nam
June Paik, in dessen künstlerischer Theorie und Praxis die Zeitmodi
fernöstlicher und westlicher Kulturen kollidieren und zu
widersprüchlichen Gebilden verknüpft werden, prägte zur
Kontextualisierung der ersten audiovisuellen Zeitmaschine Videorecorder
die Phrase: »There is no rewind button on the betamax of your life.«2
In beiden provozierenden Phrasen, in derjenigen des passionierten
Kinomachers wie derjenigen des Pioniers elektronisch vermittelter
Performanz, vibriert dieselbe Spannung. Die Zeit der Maschinen und die
Lebenszeit differieren und streiten miteinander. Paik stellt die in Form
von technischen Fragmenten reversible Zeit des Videoapparats einer
irreversiblen Zeit des Lebens gegenüber. Godard treibt diesen Gedanken
durch eine Umkehrung auf die Spitze. Die Maschinenzeit ist bei ihm
bereits in die Lebenszeit eingegangen und hat sie zu durchdringen
begonnen. Das Leben, worunter er die Gesamtheit der alltäglichen
Prozesse versteht, hat das Kino ausgesaugt und von seiner Kraft
profitiert. Jetzt möge es gefälligst die Gegenleistung erbringen.
In der Phase der Musealisierung des traditionellen
Kinematographischen soll der Profiteur in verschwenderischer
Großzügigkeit zur Re-Vitalisierung der verfügbaren Corpi beitragen.
Godard führt in seinen Histoire(s) du cinéma selbst eine Variante vor,
wie dies aussehen kann. In einer gigantischen Montage und Collage von
Fragmenten, die dem Kino entnommen sind, entsteht in elektronischer Form
die Erinnerungsarbeit eines leidenschaftlichen Filmemachers als ein
unendlich variierbares Archiv von Gesten, Gesichtern, Bewegungen,
Artefakten, Beziehungen und Rhythmen, die außerhalb der Apparate nicht
existieren können. Wie in Chris Petits Film über den Filmkritiker und
Maler Manny Farber, Negative Space3, ist die in feinste Partikel
zerlegbare und neu zusammensetzbare Zeit für ein solches Verfahren und
eine solche Ästhetik unabdingbare Voraussetzung. Das elektronische
Medium wird zu einer Möglichkeit, mit den aufgehobenen Mikrostrukturen
filmischer Zeit zu arbeiten, Chronologie und Augenblick in der
Wiederlektüre der Filmgeschichte in ein neues Spannungsverhältnis zu
setzen.
Auch ihre Zeit hat ein Verfallsdatum, aber Maschinen können länger
leben. Der Computerwissenschaftler und Ingenieur Danny Hillis, der die
massiven Parallelarchitekturen heutiger Hochleistungsrechner mit
entwickelte, stellte zum Auslaufen des 20. Jahrhunderts den Prototyp
einer Uhr vor, die im Jahr 2001 in Betrieb genommen werden und für
10.000 Jahre exakt laufen können sollte. Das aufwendige Projekt einer
Gruppe von Techno-Enthusiasten, die sich Long Now Foundation nennt,
tritt mit einem zeit-ökologischen Anspruch auf. Aber im Grunde versuchen
sich seine Protagonisten in grenzenloser Anmaßung. Das Jetzt, die
Gegenwart, soll in die Zukunft hinein gedehnt und damit tendenziell
verewigt werden. Die Vorstellung der Ablage des Verstands für
Generationen künftiger Jahrhunderte in künstlichen, dauerhaft haltbaren
neuronalen Netzen folgt derselben obszönen Idee.
»Unsere Geschlechtlichkeit […] gehört zu einer anderen
Entwicklungsepoche als unser geistiger Zustand« schrieb der polnische
Dichter Bruno Schulz aus dem winzigen Ort Drohobycz, der heute in der
Ukraine liegt, in der Fragmentsammlung seiner »Republik der Träume«4.
Maschinen haben dieses Problem nicht. Sie haben keine Sexualität. Sie
können viel schneller sein als die trägen Bio-Körper. Mit der kleinsten
Einheit digitaler Maschinen, dem bit, kann man zwar rechnen, aber es ist
der sinnlichen Wahrnehmung nicht mehr zugänglich. In zeitlicher
Hinsicht unterläuft es sie. Es wird zur Währungseinheit einer neuen
Ökonomie.
Vom Beginn des 20. bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts hat eine
markante Verschiebung in der Qualität politischer und ökonomischer
Machtbeziehungen stattgefunden, in die Medien involviert sind und die
sie zugleich vorangetrieben haben: von der Verfügung über Territorien
hin zur Verfügung über die Zeit, weniger ihre Ausdehnung betreffend als
ihre Feinstrukturierung, ihre Rhythmisierung, ihre Intensität. In Karl
Marx’ Gesammelten Werken ist das Zitat eines anonymen Zeitgenossen
erhalten, der die Vorstellung von Ökonomie, die dann der Dreh- und
Angelpunkt der Marx’schen Kritik der etablierten bürgerlichen Ökonomie
wurde, auf den Punkt brachte: »Wahrhaft reich ist eine Nation erst, wenn
kein Zins für Kapital gezahlt wird; wenn statt zwölf Stunden nur sechs
gearbeitet wird. Reichtum ist verfügbare Zeit und sonst gar nichts.« In
einer Situation, die Zeit zur wichtigsten Ressource für die Ökonomie,
die Technik, die Kunst erklärt, scheint es weniger darauf anzukommen,
wie viel oder wie wenig Zeit wir haben. Wir müssen vielmehr darauf
achten, wer über unsere Zeit und die der anderen wie verfügt. Das einzig
wirksame Mittel gegen die bittere Melancholie als Grundhaltung
gegenüber der Welt ist die Aneignung beziehungsweise Wiederaneignung der
souveränen Verfügbarkeit über die Zeit, die das Leben und die Kunst
benötigen. Nur so ist Zukunft denkbar – als ein permanentes Ding der
Unmöglichkeit.
In Martina Kudlaceks filmischer Hommage an Maya Deren5 gibt es, die
Zeit betreffend, eine elektrisierende Sequenz. In ihrem Film At Land
(1944) klettert Deren in sehr langsamen Bewegungen vom Meeresstrand über
einen archaischen Treppenbaum in eine Versammlung steifer bourgeoiser
Damen und Herren an einer langen Dinnertafel und kriecht über die weiße
Tischdecke. Im Off ertönt dazu die Stimme der Göttin der
Kino-Avantgarde. Sie reflektiert ihre eigene filmische Poesie und deren
Einbettung in verschiedene Modi des Zeiterlebens und der
Zeitwahrnehmung. Das Besondere ihrer künstlerischen Arbeit bestehe
darin, dass sie einem spezifischen Sinn für das Werden verpflichtet sei
(»sense of becoming«). Dadurch zeichne sich das weibliche Verhältnis zur
Zeit aus. Es sei geprägt durch die ständige Metamorphose innerhalb
einer chrono- und biologischen Kontinuität. Wichtiger als die Frage, was
ist, sei für sie diejenige, was aus dem werden könnte, was ist. Dem
stellt sie den starken männlichen Sinn für das Momenthafte, die
Unmittelbarkeit gegenüber. Der Mann sei eine Kreatur des Jetzt (»a now
creature«).
Siegfried Zielinski, Köln, Juni 2002
- Exhibition
- Awards
- Library
- Speech
- edition KHM
- Festival / Award ceremony
- FG exMedia
- FG Film und TV
- FG Kunst
- FG Kunst- und Medienwissenschaften
- Movie screening
- Glasmoog Books
- Glasmoog - Raum für Kunst und Diskurs
- KHM Journal
- Concert
- Cooperation
- LAB Jahrbuch
- LECTURE Reihe
- Teachers elsewhere
- literature
- off topic
- News articles
- Publications
- Job offers
- Study
- TV broadcast
- Event
- all